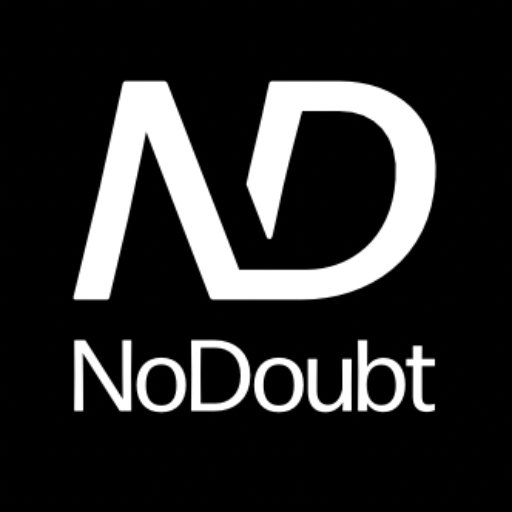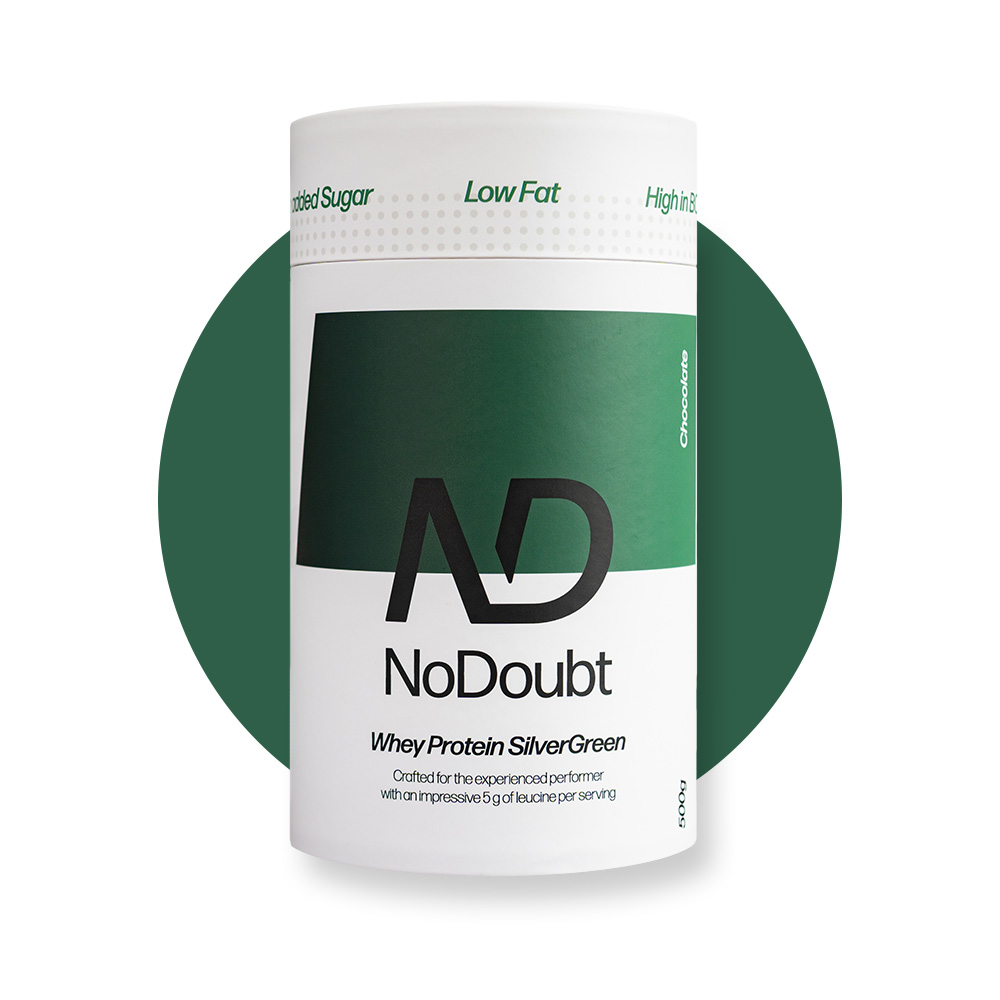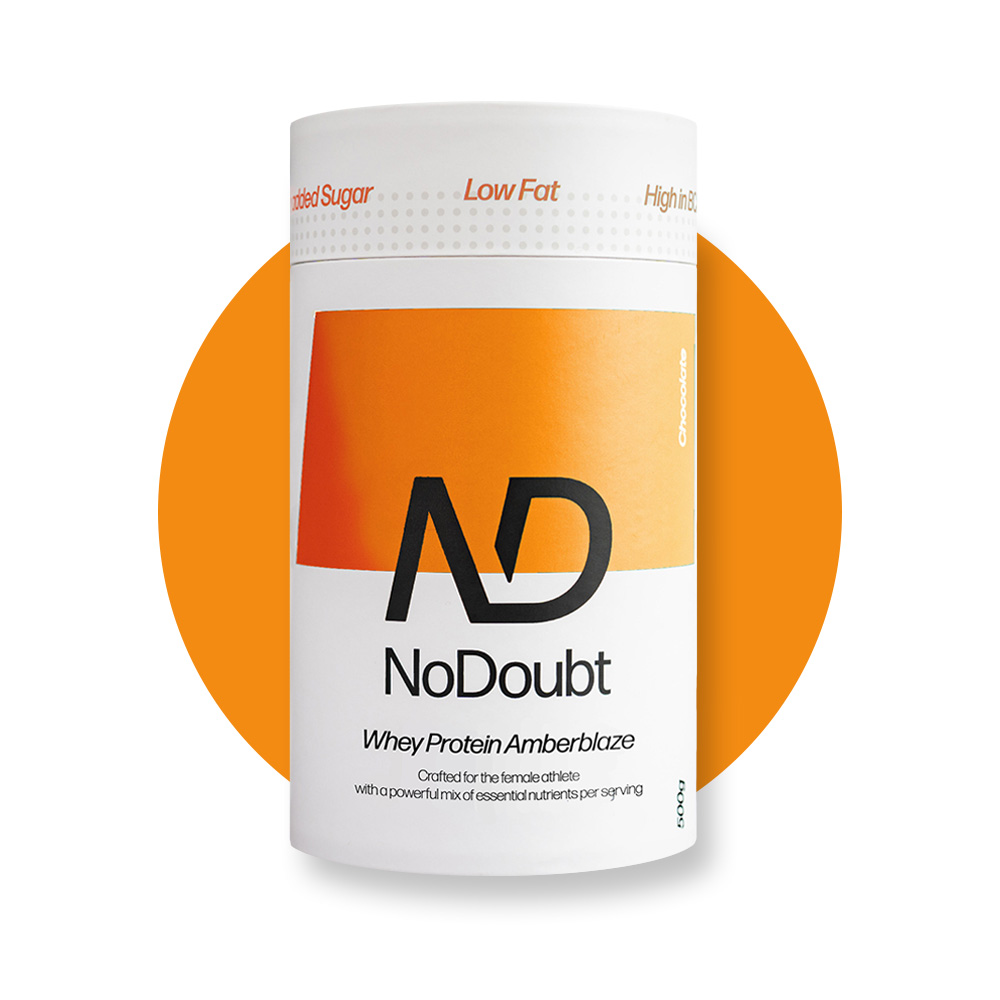Clarissa ist Teilnehmerin von Ride or Die – einem Ultraausdauer-Event, das alles andere als gewöhnlich ist. Über 1000 Kilometer führt die Strecke von Basel nach Barcelona – auf dem Fahrrad, allein, ohne Support und ohne feste Unterkunft. Ihre gesamte Verpflegung, Ausrüstung und Motivation trägt sie selbst bei sich.
Am Montag, dem 14. April, bricht sie auf. Mit nichts als ihrem Rad, einem klaren Ziel und dem unbedingten Willen, Grenzen zu verschieben. Täglich legt sie rund 300 Kilometer zurück – bei Gegenwind, durch heftige Unwetter, überflutete Strassen und tiefe Wasserlachen. Schmerzen und Erschöpfung begleiten sie, doch sie fährt weiter. Nach nur dreieinhalb Tagen erreicht sie ihr Ziel: Barcelona. Sie ist durchnässt, erschöpft – aber angekommen.
Was sie auf dieser Reise erlebt hat, wie schnell sie war und wie es den anderen Teilnehmer:innen erging, erfahrt ihr im Herbst in einer mehrteiligen YouTube-Serie. Diese Fahrt war jedoch weit mehr als ein sportliches Extremprojekt.
Denn Clarissas Ride steht sinnbildlich für eine Frage, die viele Frauen im Ausdauersport beschäftigt:
Dürfen Frauen Fettoxidation trainieren – oder ist das hormonell riskant?
Ein Thema, das häufig missverstanden wird. Zahlreiche Trainingsmodelle basieren auf Studien mit männlichen Probanden. Deshalb ignorieren sie oft die Besonderheiten des weiblichen Körpers – insbesondere im Hinblick auf Stoffwechsel, Hormone und Energieverwertung.
Ride or Die ist ein Statement: Frauen dürfen nicht wie kleinere Männer trainieren. Stattdessen können sie lernen, mit ihrem Zyklus zu arbeiten – und nicht dagegen. Fettoxidation bei Frauen ist möglich. Mehr noch: Sie kann zu einer wertvollen Strategie werden – wenn sie richtig eingesetzt wird.
Der weibliche Stoffwechsel: anders, aber nicht schwächer
Was die Sportwissenschaft heute eindeutig belegt: Der weibliche Körper funktioniert anders als der männliche – vor allem in Bezug auf Hormonhaushalt, Energieverwertung und Fettstoffwechsel.
Viele Trainingsmodelle stammen aus Studien mit männlichen Probanden. Für Frauen kann das problematisch sein – insbesondere bei Strategien wie Low-Carb-Ansätzen.
Oft liest man:
„Frauen sollen keine Fettoxidation trainieren.“
„Train Low bringt bei Frauen nichts.“
Doch solche Aussagen greifen zu kurz. Sie ignorieren zyklusbedingte Unterschiede – und sie übersehen, dass Ultraevents wie Clarissas Fahrt eine völlig andere Vorbereitung brauchen als ein einstündiger Intervalllauf.
Was sagt Stacy Sims – und was wird oft missverstanden?
Dr. Stacy Sims gilt als eine der führenden Stimmen im Bereich „Female Athlete Physiology“. In ihren Büchern und Vorträgen kritisiert sie immer wieder die pauschale Anwendung männlicher Trainingslogik auf Frauen. Besonders deutlich wird sie beim Thema Fasted Training.
Ihr oft zitierter Satz:
„Women can train with low carbohydrate availability – but they must NOT train empty.“
Auf Deutsch:
Ja, Frauen können mit reduziertem Kohlenhydratangebot trainieren. Aber sie dürfen niemals komplett nüchtern trainieren – der Körper braucht vor jeder Einheit eine minimale Energiezufuhr in Form von Protein als Schutz.
Leider wird dieser Satz oft falsch ausgelegt. Sims lehnt Fettoxidationstraining nicht grundsätzlich ab. Im Gegenteil – sie differenziert. Und genau das ist entscheidend, wenn Frauen Fettoxidation trainieren wollen – und sollen.
Train Low – ja, aber hormonfreundlich
Fettoxidationstraining – oft auch als „Train Low“ bezeichnet – bedeutet, den Körper gezielt mit niedrigen Glykogenspeichern zu belasten. Ziel ist es, seine Fähigkeit zu verbessern, Fett als primäre Energiequelle zu nutzen.
Gerade bei Ultra-Ausdauerevents ist das zentral: Die Glykogenspeicher reichen oft nur für zwei bis drei Stunden. Danach muss der Körper effizient auf Fett umschalten können. Wer das trainiert, spart Energie, schont Kohlenhydratspeicher und bleibt länger leistungsfähig.
Doch: Frauen reagieren anders auf diesen Reiz als Männer. Warum?